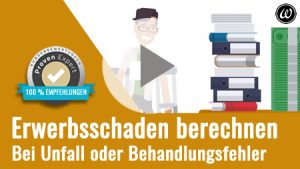Geburtsschadensrecht
Bei Geburtsschäden brauchen Sie Beistand von erfahrenen, spezialisierten und kompetenten Fachanwälten
Geburtsschäden: Rechtliche Hilfe für Eltern
Bei Geburtsschäden geht es nicht nur um höchsten Schadensersatz, der Ihrer Familie den Alltag erleichtert, sondern auch um lebenslange Zukunftsabsicherung für Ihr Kind, auch über die Lebensdauer der Eltern hinaus.
Wir zeigen Ihnen, welche rechtlichen Ansprüche bei Geburtsschäden bestehen – und wie Sie diese durchsetzen können. Auf dieser Seite finden Sie fundierte Informationen zu Behandlungs- und Aufklärungsfehlern, zur Haftung von Kliniken sowie zur Höhe von Schmerzensgeld und Schadenersatz.
Wir stehen für Ihre Rechte ein.
Seit über 25 Jahren sind wir als erfahrene Fachanwälte tätig und haben uns auf Arzthaftung und Geburtsschäden spezialisiert. Und als Patientenanwälte vertreten wir konsequent nur eine Seite: die der Patientinnen und Patienten.
Wir begleiten wir Sie Schritt für Schritt – klar, verständlich und an Ihrer Seite. Ihr Recht steht für uns im Mittelpunkt.


Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
-
Video: Schadensersatz bei Geburtsschäden
In unserem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie bei Geburtsschäden höchstmögliches Schmerzensgeld und Schadenersatz geltend machen können. Dazu gehören auch alle Ansprüche auf Erwerbs- und Haushaltsführungsschaden sowie auf Pflege- und Umbaukosten.
Sie erfahren auch, mit welchen typischen Einwänden der Gegenseite Sie rechnen müssen und wie wir als erfahrene Patientenanwälte juristisch dagegen vorgehen.
Auch die komplexe Frage der Verjährung im Arzthaftungsrecht beleuchten wir verständlich.
Schmerzensgeldtabelle gesucht?
In unserer Schmerzensgeldtabelle finden Sie Beispiele aus der Rechtsprechung mit Beträgen, die Gerichte in vergleichbaren Fällen zugesprochen haben.
Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung!
Wir besprechen mit Ihnen Ihre Situation und geben Ihnen unsere Einschätzung.
Themenübersicht
Der Alltag mit einem schwer geschädigten Kind
Die Diagnose eines Geburtsschadens stellt für betroffene Familien eine existenzielle und emotionale Belastung dar.
Eltern sehen sich nicht nur mit der Verantwortung konfrontiert, ihr Kind mit möglicherweise schweren Einschränkungen zu unterstützen, sondern auch mit der ständigen Sorge um dessen Zukunft – oft ein Leben lang. Die Pflege eines neugeborenen Kindes, das unter einem Hirnschaden oder anderen gesundheitlichen Schäden leidet, bedeutet eine enorme psychische und körperliche Überforderung.
Die Einschränkungen im Familienleben sind meist gravierend. Viele Eltern müssen ihre Lebensperspektiven und beruflichen Pläne aufgeben, der Alltag wird neu strukturiert. Gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse, die für andere Familien selbstverständlich sind, werden zur Ausnahme. Die Trauer über eine unbeschwerte Kindheit, die das betroffene Kind möglicherweise nie erleben wird, ist allgegenwärtig. Auch Geschwisterkinder geraten oft in den Hintergrund, weil die gesamte Aufmerksamkeit und Zeit in die Pflege eines schwer geschädigten Kindes fließen.
Entschädigung für Mutter, Kind und Familie
Wenn ein Geburtsschaden durch ärztliche Behandlungsfehler oder mangelhafte Aufklärung verursacht wurde, haben die betroffenen Familien Anspruch auf umfangreiche Entschädigung. Dazu zählen sowohl immaterielle Schäden (Schmerzensgeld), als auch materielle Schäden (Schadenersatz). Besonders bei hypoxischen Hirnschäden (z. B. Zerebralparese, Blindheit, Tetraparese) kann die Haftung des Krankenhauses oder Arztes erheblich sein. Hier ist eine fachkundige anwaltliche Unterstützung unabdingbar.
Wichtig ist die langfristige materielle Absicherung des Kindes – nicht nur für die Pflege und die medizinische Versorgung, sondern auch für ein möglichst selbstbestimmtes Leben über die Lebenszeit der Eltern hinaus.
Gerade bei hohen Forderungssummen kommt es jedoch oft zu Streitigkeiten mit Versicherern, die eine gerichtliche Klärung erfordern. Der Erwerbsschaden und der Haushaltsführungsschaden werden in solchen Fällen geschätzt, etwa anhand der Ausbildung der Eltern und Geschwisterkinder. Die frühzeitige Geltendmachung aller Ansprüche ist entscheidend, um eine angemessene Entschädigung zu sichern.
Mehr zu den Themen:
Bei Geburtsschäden fallen immense Kosten wie Schmerzensgeld und Pflegekosten an. Bei millionenschweren Summen mauern Versicherer oft, sodass ein durchsetzungsstarker Spezialanwalt unabdingbar ist.
Patientenanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht Dr. Dr. Lovis Wambach
Rechtliche Grundlagen zum Thema Geburtsschäden
Geburtsschäden betreffen nicht nur medizinische, sondern auch komplexe rechtliche Fragestellungen. Die Grundlage der Haftung bildet insbesondere das Patientenrechtegesetz (§§ 630d und 630e BGB). Demnach müssen werdende Mütter rechtzeitig und umfassend über die Risiken und Alternativen verschiedener Geburtsmethoden, etwa Kaiserschnitt vs. vaginale Geburt, aufgeklärt werden. Erfolgt diese Aufklärung nicht ordnungsgemäß, liegt ein sogenannter Aufklärungsfehler vor – mit Haftung des Krankenhausträgers.
Neben Aufklärungsversäumnissen können auch Behandlungsfehler haftungsrelevant sein – z. B. wenn medizinische Standards bei der Geburt unterschritten werden. Ein häufiger Fall: Sauerstoffmangel bei der Geburt, der zu schwersten gesundheitlichen Schäden führt. In besonders gravierenden Fällen kann es zur Beweislastumkehr kommen – das heißt, nicht die Familie muss den Fehler beweisen, sondern das Krankenhaus seine Unschuld.
Die Rechtsprechung, insbesondere durch den Bundesgerichtshof (BGH), hat klargestellt: Für Pflegekosten gibt es keine gesetzliche Obergrenze, auch bei häuslicher Pflege. Damit ist rechtlich anerkannt, dass betroffene Kinder im familiären Umfeld betreut werden dürfen – auch wenn dies deutlich teurer ist als ein Heimplatz.
Mehr zu den Themen:
Die Rolle des Fachanwalts für Geburtsschäden
Ein Fachanwalt für Medizinrecht, der sich auf Geburtsschäden spezialisiert hat, spielt eine entscheidende Rolle für betroffene Familien. Diese Anwälte verfügen über tiefgehende Expertise im Arzthaftungsrecht und können sich dafür einsetzen, dass die berechtigten Ansprüche ihrer Mandant:innen auch gegen große Versicherungsgesellschaften durchgesetzt werden.
Bei Geburtsschäden mit lebenslangen Folgen – wie etwa einer Tetraparese – geht es schnell um Forderungen in Millionenhöhe. Hier braucht es einen Anwalt, der gutachterlich fundierte Beweise sichern, den Sachverhalt juristisch einordnen und überzeugend argumentieren kann – außergerichtlich wie vor Gericht. Auch bei der Auswahl und Bewertung von medizinischen Gutachten sind spezialisierte Kanzleien unverzichtbar.
Darüber hinaus bieten diese Fachanwälte nicht nur juristische Unterstützung, sondern auch empathische Begleitung in einer emotional extrem belastenden Situation. Sie helfen dabei, die langfristige Versorgung des Kindes zu sichern – finanziell, pflegerisch und rechtlich – und sorgen so dafür, dass Familien nicht allein kämpfen müssen.
Vertiefender Fachbeitrag unseres Experten
Wenn Sie sich detaillierter mit den juristischen Grundlagen bei Geburtsschäden befassen möchten, empfehlen wir den Fachbeitrag von Rechtsanwalts Dr. Dr. Lovis Wambach: „Geburtsschadensrecht: Zehn Fragestellungen zum Thema Geburtsschade / Geburtsschäden“
Darin erfahren Sie unter anderem, was bei Behandlungsfehlern und Aufklärungsverstößen gilt, wie § 630a BGB anzuwenden ist und welche Ansprüche auf Schmerzensgeld und Schadenersatz bestehen. Auch wichtige Begriffe wie Beweislastumkehr oder grober Behandlungsfehler werden dort verständlich erklärt.
Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung!
Wir besprechen mit Ihnen Ihre Situation und geben Ihnen unsere Einschätzung.
Fragen und Antworten zu Geburtsschäden
-
Was ist ein Geburtsschaden?
Ein Geburtsschaden bezeichnet gesundheitliche Beeinträchtigungen, die ein Kind während der Geburt oder im unmittelbaren Zusammenhang damit erleidet. Solche Schäden können sowohl körperlicher als auch neurologischer Natur sein und wirken sich oft lebenslang auf die Entwicklung des Kindes aus. Typische Ursachen:
- Sauerstoffmangel bei der Geburt (z. B. hypoxisch-ischämische Enzephalopathie)
- Fehlerhafter Einsatz von Zange oder Saugglocke
- Versäumte medizinische Maßnahmen, z. B. verspäteter Kaiserschnitt
- Infektionen oder Medikamentenfehler im perinatalen Zeitraum
- Unzureichende Aufklärung über Geburtsmethoden oder Risiken
-
Wann besteht Anspruch auf Entschädigung bei Geburtsschäden?
Ein Anspruch auf Entschädigung besteht, wenn der Geburtsschaden auf ein Verschulden des medizinischen Personals zurückzuführen ist – etwa durch einen groben Behandlungsfehler, eine mangelhafte Aufklärung oder eine organisatorische Pflichtverletzung im Krankenhaus. Gerichte erkennen Ansprüche an, wenn nachgewiesen wird, dass medizinische Standards unterschritten wurden und der Schaden kausal auf dieses Fehlverhalten zurückgeht. Die Entschädigung dient dazu, die erlittenen Schmerzen und Beeinträchtigungen auszugleichen und eine Genugtuung für das erlittene Unrecht zu bieten.
Bei besonders schweren Fehlern greift die sogenannte Beweislastumkehr: Dann muss das Krankenhaus belegen, dass kein Fehler vorlag – nicht die Eltern müssen ihn beweisen.
-
Wie hoch kann Schmerzensgeld bei Geburtsschäden ausfallen?
Die Höhe des Schmerzensgeldes hängt von der Schwere des Schadens, den dauerhaften gesundheitlichen Folgen und dem Leidensweg des Kindes ab. Bei schwerwiegenden Fällen, wie einer dauerhaften Tetraparese oder vollständigen Blindheit, haben Gerichte in Deutschland bereits Summen von bis zu 1 Million Euro zugesprochen. Faktoren wie die Intensität der Schmerzen, der Grad der Behinderung und die Auswirkungen auf das zukünftige Leben des Kindes spielen eine wesentliche Rolle bei der Festlegung der Summe. Die Bemessung erfolgt anhand von Schmerzensgeldtabellen (z. B. bei Hirnverletzungen), früheren Gerichtsurteilen, sowie medizinischen Gutachten zur individuellen Lebensbeeinträchtigung.
In unserer Schmerzensgeldtabelle Geburtsschaden finden sie als Orientierungshilfe die Höhe von Entschädigungsbeiträgen aus vergangenen Urteilen.
-
Kann bei Geburtsschäden auch Anspruch auf materiellen Schadenersatz bestehen?
Ja. Zusätzlich zum Schmerzensgeld steht betroffenen Familien auch materieller Schadenersatz zu. Dieser soll alle konkreten finanziellen Nachteile ausgleichen, die durch den Geburtsschaden entstanden sind – oder künftig entstehen werden.
Dazu gehören insbesondere:
- Pflegekosten – auch bei häuslicher Pflege ohne Obergrenze,
- Umbaukosten für Haus, Wohnung und Fahrzeug,
- Fahrtkosten zu Therapien oder Ärzten,
- Verdienstausfall des Kindes ab dem fiktiven Berufseinstieg,
- Haushaltsführungsschaden, wenn das Kind nie selbstständig einen Haushalt führen kann,
- Mehrbedarfsschäden, z. B. besondere Hilfsmittel, Pflegehilfen oder Assistenzleistungen.
-
Wie lässt sich eine Entschädigung durchsetzen?
Der erste Schritt sollte immer die Kontaktaufnahme zu einem spezialisierten Rechtsanwalt sein. Dieser prüft die medizinischen Unterlagen, sichert Beweise und erstellt eine rechtliche Bewertung des Falls. Im Anschluss erfolgt meist ein außergerichtliches Anspruchsschreiben an das Krankenhaus oder die Haftpflichtversicherung. Viele Fälle lassen sich bereits in dieser Phase durch Verhandlung klären. Ist keine Einigung möglich, erfolgt die gerichtliche Durchsetzung.
Wichtig ist eine vollständige medizinische Dokumentation, gegebenenfalls ein unabhängiges medizinisches Gutachten, die Ermittlung aller Schadenspositionen – auch für die Zukunft – und eine konsequente rechtliche Begleitung durch alle Instanzen.
-
Was können wir als Fachanwälte für Sie tun?
Als erfahrene Fachanwälte für Medizinrecht mit Spezialisierung auf Schmerzensgeld vertreten wir ausschließlich Patientinnen und Patienten – bundesweit. Wir übernehmen für Sie:
- die Analyse Ihrer individuellen Situation und Bewertung möglicher Ansprüche,
- die Sicherung und Aufbereitung medizinischer Beweise,
- die Verhandlung mit Versicherungen über angemessene Entschädigungen,
- die Vertretung vor Gericht, falls notwendig,
- und die Durchsetzung sämtlicher Ansprüche, auch auf langfristige Versorgung und Zukunftssicherung.
Unser Ziel ist es, für Sie die maximale Entschädigung zu erreichen – rechtlich fundiert, menschlich begleitet.
Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung!
Wir besprechen mit Ihnen Ihre Situation und geben Ihnen unsere Einschätzung.
Typische Ursachen und Geschehensabläufe – Fachbeitrag von Dr. Dr. Lovis Wambach
Geburtsschadensrecht: Zehn Fragestellungen zum Thema Geburtsschaden / Geburtsschäden
Die Geburtshilfe ist das haftungsträchtigste Gebiet der Medizin.
Prinzipiell gilt bei der Missachtung des fachärztlichen Standards § 630a Abs. 2 BGB während des Geburtsvorgangs, davor oder danach, nichts anderes als bei Fehlbehandlungen gegenüber Erwachsenen. Die Möglichkeiten des Vorgehens bei Behandlungsfehlern, Aufklärungsfehlern, die Schadensersatzansprüche, die Ansprüche auf Schmerzensgeld habe ich in den entsprechenden Artikeln meines Lexikons zum Arzthaftungsrecht dargestellt. Das Lexikon finden Sie hier: Lexikon der Patientenrechte – Patientenlexikon. Dort finden sich auch die hier erwähnten Begriffe Beweislastumkehr und Behandlungsfehler (auch grober) ausführlich kommentiert. Außerdem finden sich eine Übersicht über die Handlungsmöglichkeiten unter: Arzthaftung.
1. Der vorzeitige Blasensprung ist ein Notfall, wenn er vor dem Einsetzen der Wehen erfolgt. Er birgt das Risiko von Nabelschnurkomplikationen und Infektionen. Er erfordert eine sofortige Einweisung in die Klinik und ständige ärztliche Überwachung und engmaschige Kontrolle. Nach Ablauf von 24 Stunden seit dem Blasensprung ist entweder eine medikamentöse Geburtseinleitung oder eine antibiotische Abschirmung vorzunehmen, ansonsten sind die Kontrollmaßnahmen über den üblichen Standard hinaus zu intensivieren. Wird die nach einem vorzeitigen Blasensprung in der 36. Schwangerschaftswoche gebotene Kaiserschnittentbindung hinausgezögert, so liegt ein grober Behandlungsfehler vor, der dem Arzt die Beweislast für das Fehlen der Schadensursächlichkeit auferlegt (Beweislastumkehr bei groben Behandlungsfehlern, § 630h Abs. 5 BGB).
2. Der Herztonwehenschreiber – Kardiotokograph (CTG) zeichnet die Herztöne des ungeborenen Kindes und parallel dazu die Wehen der Mutter auf. Besonders die Auswertung dieses Diagramms zeigt, ob das Kind gesund ist oder aber sich in einer Notlage befindet und damit auch, ob ein Notfallkaiserschnitt erforderlich ist. In einem Prozess kann ein gerichtlicher Sachverständiger anhand der Kardiotokographieaufzeichnungen rekonstruieren, ob und ab welchem Zeitpunkt die Notlage von Arzt oder Hebamme hätte erkannt werden müssen und daraufhin weitere Maßnahmen, insbesondere eine Notfallkaiserschnitt hätte vorgenommen werden müssen. Diese Aufzeichnungen müssen im Schadensfall unbedingt gesichert werden!
3. Die Erstversorgung des Neugeborenen fordert, dass das neugeborene Kind in den ersten 20 Minuten nach der Geburt überwacht werden muss. Für den Notfall hat der Krankenhausträger ausreichende organisatorische Vorkehrungen (siehe unter: Organisationsverschulden) zu treffen, insbesondere ist sicherzustellen, dass beim Auftreten von Atemnot ein kompetenter und erfahrener Arzt hinzugezogen wird.
Wenn das Pflegepersonal eines Belegkrankenhauses bei einer nach mehreren Stunden nach der Geburt auftretenden bläulichen Verfärbung von Gesicht und Händen des Neugeborenen nicht unverzüglich einen Arzt hinzuzieht, liegt ein grobes Fehlverhalten vor (§ 630h Abs. 5 BGB). Es liegt gleichfalls ein grober Behandlungsfehler (§ 630h Abs. 5 BGB) vor, wenn die Temperatur eines Frühchens (siehe dort) nicht ausreichend überwacht wird und es deshalb zu einer andauernden Unterkühlung kommt, die möglicherweise zu einer Hirnblutung geführt hat. Weitere Voraussetzung ist, dass die Unterkühlung generell geeignet war, eine Hirnblutung hervorzurufen (Beweislastumkehr bei groben Behandlungsfehlern, § 630h Abs. 5 BGB).
4. Die Frühgeburt ausnehmend unreifer Frühgeborener muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.
Wenn die Frühgeburt nicht verhindert werden kann, gilt: Die wichtigste Voraussetzung, um den Tod oder die lebenslange Behinderung Frühgeborener zu vermeiden, stellt die Geburt in einem Perinatalzentrum dar (Perinatalzentrum / griechisch perí = nahe bei und lateinisch natalis = die Geburt betreffend). Es stellt einen schwerwiegenden Fehler dar, wenn die Lungenreife bei drohender Frühstgeburt nicht durch die Gabe von Cortison beschleunigt wird. Die Lungenreife ist für Frühchen überlebensentscheidend.
5. Die Hebamme ist in der Lage eine Geburt ohne Komplikationen selbständig, ohne den Beistand eines Arztes durchzuführen. Die Hebamme darf bei Normalgeburten bestimmte diagnostische und therapeutische Maßnahmen vornehmen. Unterläuft ihr hierbei ein Fehler, kann sie genauso wie ein Arzt haftbar gemacht werden. Sobald Anzeichen für Komplikationen zu erkennen sind, muss die Hebamme einen Arzt herbeiholen. Unterlässt sie das, steht sie in der Haftung. Auch eine parallele Haftung von Arzt und Hebamme kommt vor; manchmal ist zusätzlich der Krankenschwester oder einem Krankenpfleger ein Fehlverhalten vorwerfbar.
6. Die hirnorganische Schädigung durch eine Fehlbehandlung während der Geburt (etwa durch Komplikationen mit der Nabelschnur und des dadurch ausgelösten Sauerstoffmangels) ist das größte Unglück für Kind und Eltern. Eine solche Schädigung kann lebenslanges Leid bedeuten. Schwerste Hirnschädigungen degradieren ein Kind nicht nur zum Pflegefall; sie können durch den Fortfall der Empfindungsfähigkeit die Persönlichkeit zerstören. Über Entschädigungen dieser schwersten Schäden informieren wir Sie unter unserem Themenpunkt Arzthaftungsrecht.
7. Der Kaiserschnitt, auch sectio genannt (sectio = lat. Schnitt) kommt bei einer normalen Entbindungssituation nicht in Betracht, da sie nicht indiziert ist. Deshalb ist er erst dann eine Alternative zur vaginalen Geburt, wenn für das Kind ernstzunehmende Gefahren drohen und deshalb im Interesse des Kindes gewichtige Gründe für eine Schnittentbindung sprechen (etwa: Beckenendlage, abgeklemmte Nabelschnur). Der Bundesgerichtshof (BGH) sagt: Die Mutter muss die grundlegende Entscheidung treffen, ob sie selbst das Risiko einer Schnittentbindung auf sich nimmt oder ob das Verletzungsrisiko beim Kind bleiben soll. Die Mutter ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die „natürliche Sachwalterin der Belange des Kindes“.
Da die Entscheidung außerordentlich schwierig ist, gebietet das Selbstbestimmungsrecht eine umfassende Aufklärung über das Für und Wider (§ 630d BGB, § 630e BGB) von vaginaler- und Schnittgeburt. Das Recht jeder Frau, selbst darüber bestimmen zu dürfen, muss möglichst umfassend gewährleistet werden. Der Bundesgerichtshof fordert: Die werdende Mutter darf während des Geburtsvorgangs aber auch nicht ohne Grund mit Hinweisen über die unterschiedlichen Gefahren und Risiken der verschiedenen Entbindungsmethoden belastet werden, und es sollen ihr nicht Entscheidungen für eine dieser Methoden abverlangt werden, solange es noch ganz ungewiss ist, ob eine solche Entscheidung überhaupt getroffen werden muss. Darüber hinaus muss jede Aufklärung auch einen konkreten Gehalt haben; ein Aufklärungsgespräch auf so unsicherer Grundlage müsste weitgehend theoretisch bleiben. Die Aufklärung muss aber trotzdem so rechtzeitig wie möglich erfolgen. Wenn sich deutliche Anzeichen dafür entwickeln, dass sich der Geburtsvorgang in die Richtung auf die Entscheidungssituation hin entwickeln kann, in der eine Schnittentbindung notwendig oder zu einer echten Alternative zur vaginalen Entbindung wird, muss sofort aufgeklärt werden. Dies gilt umso mehr, wenn die Mutter – etwa wegen der schleppend verlaufenden Geburt – nach einer Schnittgeburt verlangt hat. Anzeichen für eine Risikogeburt können sich beispielsweise aus Veränderungen der Herzfrequenz des Kindes ergeben (siehe oben unter: CTG). Zwischen dem Entschluss zur Notsectio und deren Durchführung soll möglichst wenig Zeit vergehen; keinesfalls sollte es länger als zwanzig Minuten dauern.
8. Das Organisationsverschulden führt zur Haftung. Organisationspflichten des Krankenhausträgers ergeben sich beispielsweise in Bezug auf Personal, Apparate, Aufsicht und Überwachung des Personals. Beispiele für Organisationsverschulden während der Geburt sind: Wenn eine CTG-Überwachung (siehe dort) durch eine geburtshilflich nicht qualifizierte Nachtschwester und die CTG-Auswertung durch eine Hebamme erfolgt. Ein Organisationsfehler ist ebenso zu bejahen, wenn eine Hebamme bei einer Risikogeburt mit einer Schulterdystokie (siehe dort) die Geburtsleitung übernimmt. Der Krankenhausträger haftet für Geburtsschäden eines Kindes, wenn er keine hinreichende organisatorische Vorsorge dafür getroffen hat, dass bei jeder Entbindung ein Arzt anwesend ist oder jedenfalls auf ein Rufzeichen der Hebamme sofort eintrifft, um die Diagnose zu sichern und notwendige ärztliche Maßnahmen zu ergreifen. Ein Krankenhaus muss sicherstellen, dass spätestens fünfzehn Minuten nach der notfallmäßigen Aufnahme einer Schwangeren mit Blutungen und Schmerzen im Unterbauch eine Untersuchung stattfindet und Behandlungsmaßnahmen eingeleitet werden und dass eine erforderliche sofortige Schnittentbindung innerhalb von zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten nach Indikationsstellung durchgeführt wird.
9. Die Schulterdystokie ist eine schwerwiegende Geburtschädigung: Während der Geburtsphase bleibt eine Schulter über der Schambeinfuge hängen. Als Folge kann das Armnervengeflecht verletzt werden. Das führt zu einer Störung der Armbewegung und –sensibilität unterschiedlicher Ausprägung. Je nach Anzahl der beteiligten Nervenwurzeln und der Schwere der Schädigung ist die Ausprägung der Lähmung umfangreich und lang anhaltend. Bei schweren Verletzungen kommt es zu einer dauerhaften Einschränkung der Beweglichkeit des Armes, zu bleibenden Sensibilitätsstörungen, zu einem veränderten Wachstum der Extremität und zu einer eingeschränkten Gebrauchsfähigkeit mit sekundären psychosozialen Folgen.
Es gibt verschiedene umstrittene Manöver, das Kind schnellstmöglich herauszuziehen, um Verletzungen zu vermeiden. Aber auch hierbei können Fehler unterlaufen, wenn etwa das falsche Manöver angewandt wird oder der Arzt am Kopf des Kindes zieht. Der Gefahr einer Schulterdystokie kann man mit einem Kaiserschnitt entgegenwirken. Da auch ein Kaiserschnitt nicht ungefährlich ist, müssen die Risiken abgewogen werden. Wenn Risikofaktoren vorliegen (beispielsweise: sehr schweres großes Kind = über 4000 Gramm, eine vorangegangene Schultersystokie bei einer früheren Geburt, Übergewicht und Diabetes bei der Mutter) muss aufgeklärt werden (Aufklärung). Siehe auch oben unter: Kaiserschnitt.
10. Die Verjährung stellt im Sinne des Rechtsfriedens sicher, dass ein Anspruch nicht für alle Ewigkeit verfolgt werden kann. Die dreijährige Regelverjährung (§ 195 BGB) beginnt frühzeitig an dem Schluss des Jahres an dem das Kind (oder die Eltern) Kenntnis von dem Behandlungsfehler erhalten (§ 199 BGB). Das birgt Risiken. Diese habe ich in einem gesonderten Artikel ausführlich beschrieben, siehe: „Verjährungsfallen im Arzthaftungsrecht. Die Verjährung in medizinrechtlichen Fällen birgt viele Fallstricke“. In jedem Fall gilt: Wenn Verjährung droht, müssen unverzüglich Mittel ergriffen werden, um sie zu hemmen (§§ 203, 204 BGB), da ansonsten der Eintritt der Verjährung die Geltendmachung der Ansprüche für immer ausschließt. Dieser Fall ist bei Geburtsschäden dramatisch.
Dr. Dr. Lovis Wambach, Fachanwalt für Medizinrecht und Arzthaftungsrecht in Bremen
Erklärvideos zu Schmerzensgeld und Schadensersatz
Unsere von uns selbst ausgearbeiteten Erklärvideos geben Ihnen einen Überblick über die immense Höhe bei der Regulierung der infrage kommenden Schadensposten, etwa der Pflegekosten, des Erwerbsschadens, dem behindertengerechten Umbau von Immobilie und Auto, gleichfalls enthalten sie auch praktische Tipps: